Wie können sie einen Ausweg aus der Kirchenkrise finden ?
Jährlich verliert die katholische Kirche in Deutschland mehr als eine halbe Million Mitglieder, mit steigender Tendenz. Die Gottesdienste werden nur noch von etwa 5 % der Katholiken besucht, mit abnehmender Tendenz. Es gibt immer weniger Priester und das Zölibat. Die Frage der Ungleichbehandlung von Männern und Frauen, von Geweihten und Laien, die den Menschenrechten widerspricht, und dann noch die Missbrauchsfälle in der Kirche und deren schleppende Aufarbeitung, all das und noch vieles mehr ruft weltweit nach Reformen, die aber seit Jahrzehnten nicht eingeleitet werden.
Die Bischöfe haben sich mit einem Eid verpflichtet, die ihnen überlieferte und offenbarte Glaubenswahrheit zu bewahren und sogar mit ihrem Leben zu verteidigen.
Wie kommen unsere Bischöfe aus dieser Zwickmühle heraus, in der die Kirche seit Beginn der Neuzeit steckt? Sie haben sich mit einem Eid verpflichtet, die ihnen überlieferte und offenbarte Glaubenswahrheit zu bewahren und sogar mit ihrem Leben zu verteidigen. Sie können gar nicht anders, sie müssen der wissenschaftlichen Theologie, die in fast allen theologischen Fachbereichen neue Möglichkeiten der Interpretation aufzeigt, widersprechen. Denn manche dieser Reform-Vorschläge widersprechen den traditionellen Vorstellungen von Glaube und Wahrheit, wie beides in der Kirche gelehrt und gelebt wird.
Hier ist ein neues Denken (metanoia) notwendig. Und dazu müssen wir etwas tiefer und grundsätzlicher graben und verstehen, wie unser menschliches Erkennen funktioniert. Dieser Frage sind bereits die alten Philosophen nachgegangen und sind zu erstaunlichen Erkenntnissen gekommen, genau wie die Neurowissenschaft. Und die Frage nach der Erkenntnis spitzt sich bei Sokrates zu, wenn er sagt: Ich weiß, dass ich nicht weiß.
In den letzten Jahren hat der Konstruktivismus auf die Frage, wie wir etwas erkennen, eine fundierte Antwort gegeben. Leider ist dieser Ansatz noch nicht in der Theologie und auch noch nicht bei vielen Bischöfen angekommen. Ich kann hier keine wissenschaftliche Abhandlung über den Konstruktivismus abliefern, sondern ich möchte an ganz einfachen Beispielen zeigen, wie unser konstruktivistisches Erkennen funktioniert.
Wenn dies nachvollziehbar ist, können die Bischöfe in aller Freiheit neu denken und Schrift und Tradition daraufhin untersuchen, was denn alles als menschliches Konstrukt aus dem zu schützenden Glaubensgut entfernt werden kann.
Die Bischöfe können gar nicht anders, als die notwendigen tiefergehenden Reformen abzulehnen.
Die katholische Kirche steckt in einer Zerreißprobe zwischen Reformern, Konservativen und dem Evangelium – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Weil Reformen offensichtlich notwendig sind, hat sich die katholische Kirche in Deutschland auf den recht umstrittenen Synodalen Weg gemacht. Meine Befürchtung ist, dass der Synodale Weg nicht die notwendigen Reformen bewirkt, weil die allein entscheidungsberechtigten Bischöfe aufgrund ihres Gehorsamsgelöbnisses gegenüber dem Papst und ihrer Selbstverpflichtung den einen offenbarten Glauben zu bewahren, gar nicht anders können, als die notwendigen tiefergehenden Reformen abzulehnen. Ich möchte keinem dieser Geweihten den guten Willen absprechen, und appelliere deshalb an alle, die guten Willens sind, mich auf dieser Reise zu begleiten. Ich möchte einen logischen und – wie ich meine – nachvollziehbaren Weg aufzeigen, wie sich die Kirche dogmatisch und kirchenrechtlich erneuern lässt, ohne das Evangelium Jesu zu verlassen, sondern es zu neuer Wirksamkeit zu bringen. Das würde vielleicht auch dazu führen, dass die Menschen wieder die Nahrung aus dem Evangelium bekommen, die sie heute nicht erhalten.
Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir etwas erkennen und dieses „Erkannte“ zu unserer „Glaubenswahrheit“ machen.
Die Themen, die ich anschneiden will, sind vielfach diskutiert, ob es um Textkritik zur Bibel oder um Fragen der Dogmatik oder des Kirchenrechts geht. Die neuen „Wahrheiten“ sind bekannt und in der einschlägigen Literatur werden Einzelfragen viel umfassender behandelt als ich es hier kann. Auch die Bischöfe kennen diese Argumente, aber sie haben die Verpflichtung, Schrift und Tradition zu wahren und kommen deshalb aus ihrem „Glaubenskonstrukt“ nicht heraus. Aber es gibt einen Weg, der m. E. zielführend aus diesem Dilemma sein kann. Dazu müssen wir uns die Frage stellen, wie wir Menschen etwas erkennen und dieses „Erkannte“ zu unserer „Glaubenswahrheit“ machen. Dazu möchte ich mit einem einfachen Beispiel, der „Erbsünde“, anfangen, weil hier Grundlegendes über den Menschen und seine Beziehung zu Gott beschrieben und festgelegt wurde und immer noch wird. Und dann möchte ich kurz den Konstruktivismus und seine Bedeutung für unsere Glaubensvorstellungen vorstellen
Was erwartet Sie auf dieser Reise? In kurzen Etappen möchte ich die Grundlagen unseres Glaubens, unseres Verstehens und unserer Erkenntnismöglichkeit betrachten und immer danach fragen, was sie mit dem täglichen praktischen Leben zu tun haben. Denn alles, was unser tägliches Leben und Handeln nicht verändert, hat so gut wie keine Relevanz und wird oder ist bereits bedeutungslos.
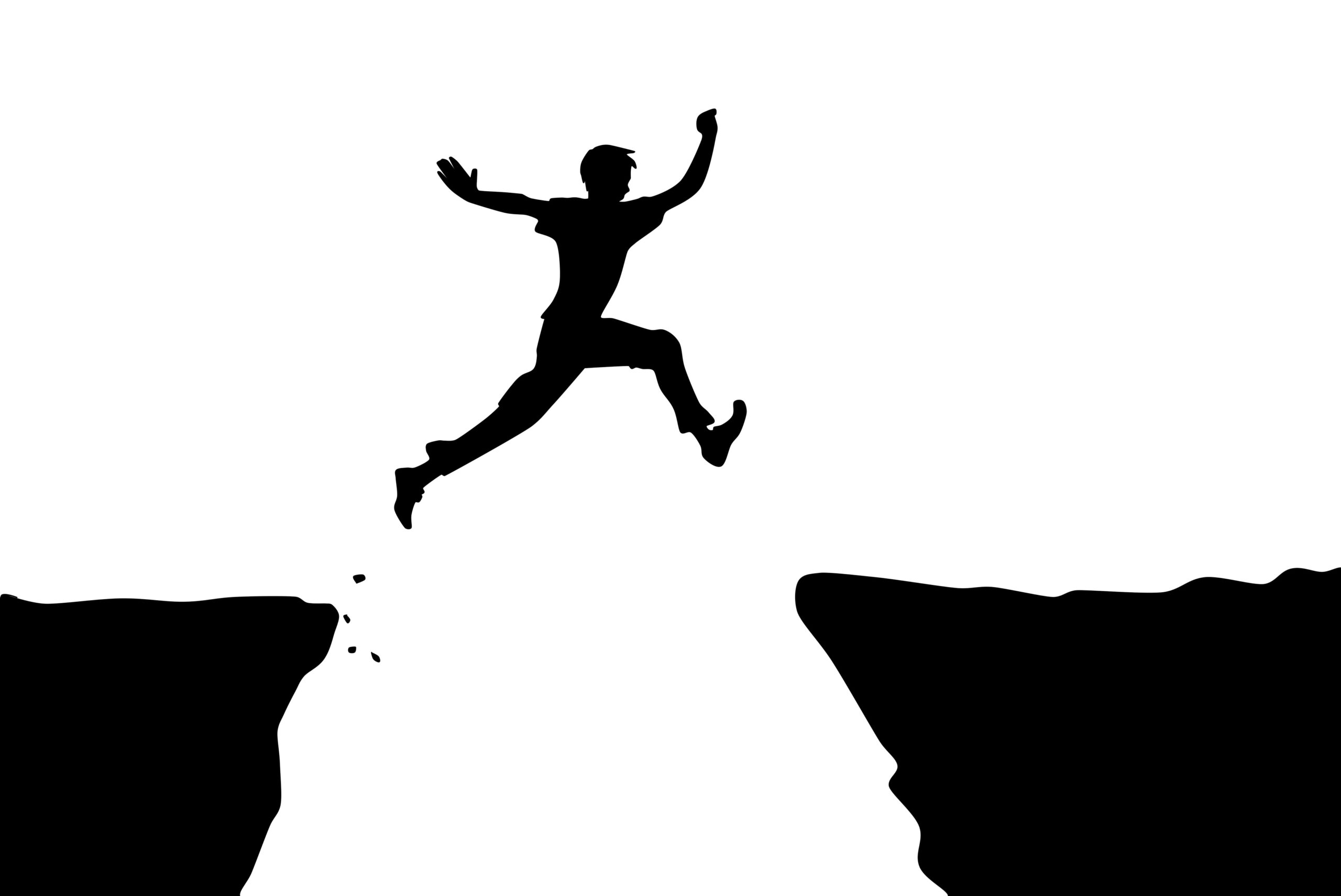
Schreibe einen Kommentar