Von Wahrnehmung zur Wahrgebung – oder
die Kontextabhängigkeit von Wahrheit.
Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse den theologischen Glaubensaussagen eines Konzils die Basis, aus denen diese abgeleitet wurden, entziehen, dann geht es hier um die Glaubwürdigkeit von Dogmen und auch um die Unfehlbarkeit der Kirche und des Papstes. Und es lohnt sich, hier etwas genauer hinzusehen. Worum geht es überhaupt? Eigentlich geht es um das Grundproblem des Erkennens, das fast die gesamte Philosophie bis heute durchzieht, von Platons Höhlengleichnis bis zum Konstruktivismus, der m. E. eine sehr schlüssige Antwort darauf liefert, wie wir etwas erkennen.
Die meisten Menschen werden beim Betrachten des Beitragsbildes die Mona Lisa wiedererkannt haben, aber warum? Weil wir das Originalbild schon gesehen haben und unser Gehirn uns eine Wieder-Erkenntnismöglichkeit anbietet, immer abhängig von unseren Vorerfahrungen oder Vorkenntnissen. Unser Gehirn ist eben kein Rekorder sondern ein Interpreter.
Ein Gegenstand reflektiert Licht, das von unserem Auge aufgefangen wird. Dieser Impuls wird über die Sehnerven an das Gehirn weitergeleitet und dort aufgrund von Vorerfahrungen in ein sinnvolles Bild umgewandelt. Unser Gehirn können wir dabei mit der Grafikkarte eines Computers vergleichen. Das Problem ist, dass durch diesen Übertragungsweg und durch die Neukonstruktion des Abbildes durch das Gehirn auch Veränderungen gegenüber dem Original auftreten können. Ein anderes Beispiel soll das verdeutlichen:
„Gmäeß eneir Stuide eneir elgnihcesn Uvinisterät, ist es nchit so witihcg in wlecehr Rneflogheie die Bstachuebn in eneim Wort snid, das ezniige was wcthiig ist, ist das der estre und der leztte Bstabchue an der ritihcegn Pstoiion snid. Der Rset knan ein ttoaelr Bsinöldn sien, tedztorm knan man ihn onhe Pemoblre lseen. Das ist so, weil wir nicht jeedn Bstachuebn enzelin leesn, snderon das Wort als gseatems.“[1]
Unser Gehirn versucht, dem, was es wahrnimmt, einen Sinn zu geben.
Ein Kauderwelsch, und trotzdem kommt unser Gehirn damit zurecht und formt daraus einen vollständigen Satz – eine Neuschöpfung aus dem Durcheinander. Unser Gehirn kommt also mit geringen und sogar bruchstückhaften Informationen zurecht, indem es versucht, dem, was es wahrnimmt, einen nachvollziehbaren Sinn zu geben. Wäre dieser Text in einer uns unbekannten Sprache geschrieben, so hätten wir keine Chance, diesen zu verstehen beziehungsweise zu interpretieren. Unsere Vorerfahrungen – in diesem Fall die Sprache – sind also ausschlaggebend für unsere Interpretation der Wirklichkeit bzw. für unser Konstrukt. Das Gehirn arbeitet somit selbstreferenziell und alles, was von der äußeren Wirklichkeit gewusst werden kann, ist eine Neuschöpfung, ein Konstrukt des Beobachters. Wie und als was wir etwas erkennen, ist deshalb maßgeblich vom Innen determiniert. Erst durch die immense Fähigkeit des Gehirns zur Komplexität werden Bedeutung und Wirklichkeit und damit auch unser ICH erzeugt. Diese konstruierende Tätigkeit des Gehirns wird durch zahlreiche neurobiologische Untersuchungen bestätigt, und insgesamt wird damit die Theorie des Konstruktivismus unterstützt.
„Erkenntnis ist – wenn sie gelingt – ein Abbild der Wirklichkeit. Das Erkenntnisideal ist „Objektivität“, d. h., unterschiedliche Beobachter, die dasselbe Objekt untersuchen, sollten zu denselben Ergebnissen kommen, weil ihre Aussagen von den Eigenschaften des Objektes und nicht von der Prozedur der Beobachtung oder den Eigenarten des Beobachters bestimmt werden.“[2]
An Gott zerbrechen alle unsere Konstrukte.
Die Kirche behauptet nun, durch Schrift, Tradition und Erfahrung Dogmen über Gott und den Glauben mit letzter Verbindlichkeit verkünden zu können, ja sogar zu müssen. Sie nimmt das für sich in Anspruch, um den Gläubigen eine sichere Orientierung zu geben. Aber Gott ist für den Menschen nicht einfach zu beobachten, deshalb können Aussagen über Gott niemals objektiv sein, weil wir Gott niemals „im Griff haben“ bzw. ihn auch nicht „begreifen“ können. An Gott zerbrechen alle unsere Konstrukte. Die Aufforderung: „Du sollst dir kein Gottesbild machen!“[3] kann man auch anders interpretieren: „Du KANNST Dir kein Bild von Gott machen!“
In der Kirche haben viele Menschen subjektive Erfahrungen mit Gott gemacht und sich darüber ausgetauscht und Gemeinsamkeiten in ihren Erfahrungen festgestellt. Das Denken eines Menschen ist kein für sich alleinstehendes Ereignis, es befindet sich immer in einem sozialen Kontext und im Dialog. Und so werden auch gemeinschaftlich Konstrukte der Wirklichkeit geschaffen, beziehungsweise gemeinschaftlich Begrifflichkeiten zugewiesen. Diese Erkenntnisse oder Wahrheiten finden wir in den Heiligen Schriften und Zeugnissen und später auch in den Glaubensüberzeugungen, Lehrsätzen und Dogmen. Menschen sind immer auf Gemeinschaft angewiesen und ausgerichtet und wollen zu einer Gemeinschaft gehören, die ihnen Sicherheit gibt. Gemeinschaft braucht Identität und da sind gemeinsame Lehraussagen und Dogmen identitätsstiftend und verschaffen ein Gefühl von Zugehörigkeit, wenn alle das Gleiche glauben.
Die Äußerung eines Menschen und auch einer Gemeinschaft kann somit immer nur innerhalb seiner eigenen oder der gemeinschaftlichen Konstrukte, der jeweils aktuellen Welterfahrung erfolgen. Diese Konstrukte, wie in unserem Beispiel das Konstrukt über Adam und Eva, sind also immer die Basis oder das Mittel, mit dem der Mensch etwas zum Ausdruck bringen kann. Das heißt, alle Aussagen – auch die der Propheten und sogar von Jesus – sind immer konstruktivistisch gefärbt. Weil der Mensch nur innerhalb seiner Konstrukte etwas erkennen und auch ausdrücken kann. Deshalb muss immer das Ausgangskonstrukt, die vorherrschende Weltanschauung in einer bestimmten Zeit bei einer Aussage mitberücksichtigt werden, wenn wir alte und neue Texte oder Lehraussagen betrachten. Wenn wir die Aussagerichtung einer Aussage, also ihr Aussageziel, möglichst treffend erfassen wollen, müssen wir den Aussagekontext mitberücksichtigen. Denn wenn die „Wahrheit“ nur im jeweiligen Konstrukt erkannt und benannt werden kann und die Konstrukte sich im Laufe der Zeit ändern, dann sind auch die jeweiligen „Wahrheiten“ veränderbar.
Jede Aussage hat mindestens zwei Bestandteile, die Aussagerichtung und den Aussagekontext in dem diese erklärt wird.
Um es noch etwas konkreter zu formulieren: Jede Aussage – und mit ihr jede „Wahrheit“ – hat mindestens zwei Bestandteile, die Aussagerichtung und den Aussagekontext, also das innere Konstrukt aus den Vorerfahrungen, mit dem die Aussage interpretiert wird. Eine Wahrheit ist folglich immer nur im jeweiligen Aussagekontext wahr. Ändert sich der Kontext, kann sich damit auch die Wahrheit verändern. Um es noch etwas pointierter zu formulieren: Die vermeintliche Unfehlbarkeit von Kirche und Lehramt gilt maximal nur in ihrem jeweiligen Aussagekontext. Hinzu kommt, dass jeder Mensch seine eigenen Vorerfahrungen und Konstrukte hat, mit denen er Glaubenswahrheiten, die ihm angetragen werden, interpretiert und zu einem eigenen Konstrukt macht. Somit wird es also zu den Glaubensaussagen der Kirche ebenso viele Interpretationen geben, wie es Menschen gibt. Wir können nicht von „Der Wahrheit“ ausgehen. Es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Es gibt sicher viele Gemeinsamkeiten in diesen vielen Wahrheiten, vor allem wenn es um wissenschaftlich nachweisbare Fakten geht. Die Abweichungen der jeweiligen „Vorstellungen“ werden aber umso größer, je mehr es sich um transzendente Begriffe oder Glaubenssätze handelt.
Wenn unsere Wirklichkeitskonstruktionen passen, sich also in der Realität bewähren, ist alles O.K. Wenn sie jedoch scheitern, müssen sie überprüft und angepasst werden. Erkenntnis – auch die von theologischen Wahrheiten – ist somit immer auch ein evolutiver Anpassungsprozess, der das Überleben und Funktionieren eines Systems sicherstellt. Zunächst sind alle Konstrukte gleichwertig und haben keinen Anspruch auf Höherwertigkeit. Erst in der Auseinandersetzung zeigt sich die Belastbarkeit eines Erkenntniskonstrukts. Seit Beginn der Neuzeit befindet sich die Kirche in der Auseinandersetzung mit der aktuell erfahrbaren Wirklichkeit aus Wissenschaft, Psychologie und Humanismus und sie hat diese Erkenntnisse noch nicht in ihre Glaubensaussagen integriert.
Halten wir fest:
- Wir haben keinen direkten Zugriff auf die Wirklichkeit, sondern konstruieren uns unsere Welt jeweils neu, sowohl als Einzelperson wie auch als Gemeinschaft. Wir können die Wirklichkeit – auch Offenbarungen – immer nur im Rahmen unserer bisherigen Erfahrungen und den daraus resultierenden Konstrukten wahrnehmen und mitteilen.
- Dabei interpretieren wir die Gegebenheiten mittels unserer Konstrukte, zu denen persönliche und gemeinschaftliche Vor-Erfahrungen, Weltanschauungen und Wertvorstellungen gehören. Und wir versuchen dabei zu einem sinnvollen Ergebnis zu gelangen.
- Jeder Mensch – auch Propheten und Jesus sind hier eingeschlossen – kann sich immer nur innerhalb seiner Konstrukte äußern, wobei Konstrukte sich ändern können, wenn sie sich mit der Realität nicht mehr in Einklang bringen lassen.
- Alle Lehraussagen der Kirche sind auf die dahinterstehenden Konstrukte – ihren Aussagekontext – und auf ihre Aussagerichtung hin zu überprüfen. Wie wir bereits bei der Erbsünde sahen.
Ein weiteres Beispiel, welches dieses Erkenntnisprinzip deutlich machen kann:
Die Frau soll sich unterordnen?
Wenn in alten Zeiten der Sämann den Samen über den Acker streute, war klar, dass im Samen die vollständige Anlage für die Pflanze vorhanden war. Der Same benötigte nur den Acker oder Mutterboden um aufgehen und wachsen zu können. Jeder konnte das sehen, und es war natürlich ganz einfach, dieses Muster auch auf Mann und Frau zu übertragen. Die Frauen wurden lediglich als Empfangende und Wachstum fördernde Nährmütter angesehen. Wichtig für die Fortpflanzung und den Erhalt der Lebenslinie war allein der Mann – ein Konstrukt, dass sich lange als allgemein anerkannt halten konnte. Und der Mann hatte, aufgrund seiner körperlichen Überlegenheit, die Möglichkeit diese Ansicht auch in Familie, Gesellschaft und Kultur gegenüber den Frauen durchzusetzen und ihnen eine untergeordnete Rolle in der Gesellschaft zuzuweisen.
Erst als die Wissenschaft mithilfe des Mikroskops die Entstehung menschlichen Lebens aus Ei- und Samenzelle nachweisen konnte, brach das alte Konstrukt der Überlegenheit des Mannes zusammen und die Menschenrechte proklamieren heute die Gleichberechtigung von Frau und Mann. Leider beharrt die Kirche noch auf dem alten und inzwischen unhaltbaren Konstrukt, dass Männer etwas Besonderes sind, weil Jesus Mann war und nur Männer als Apostel bestellt hat. Auch wenn Jesus bewusst nur Männer berufen hätte, müsste hinterfragt werden, aufgrund welchen Konstruktes seiner Zeit und Gesellschaft er nur Männer berufen hat. Wenn wir also das Konstrukt Patriachat wegnehmen, bleibt nur die volle Gleichberechtigung und volle Gleichwertigkeit von Mann und Frau, wie Paulus es bereits im Galaterbrief ausdrückt: „Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr seid alle eins in Christus Jesus.“[4] Und wer beruft denn die Menschen zum Dienst in der Kirche – Gott! Und der ist nach heutigen Vorstellungen nicht an ein Geschlecht gebunden, weil Gott alles in allem ist. Wir können an all diesen Beispielen sehen, dass sich Glaubens-, Sitten- und Moralvorstellungen immer auch aus den jeweiligen Weltanschauungen, Erfahrung und Erkenntnissen, also unseren Konstrukten speisen. Ohne Konstrukte keine Aussage über die Wahrheit! Damit ist jede „Wahrheit“ immer von den jeweiligen Konstrukten in Zeit und Ort und Menschen abhängig.
Konstruktivismus und die Bibel
Wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen und von göttlich inspiriertem Text sprechen, so müssen wir uns vor Augen halten, dass das Göttliche transzendent ist und nicht mit unseren Begriffen beschrieben werden kann. Die Schreiber der Bibel haben es dennoch versucht, ihre Erfahrungen zu verschriftlichen, allerdings hatten sie nichts anderes zur Verfügung als ihre seinerzeit verinnerlichten Konstrukte. So ist es nicht verwunderlich, dass sich die Gottes-Vorstellungen im Laufe der Zeit und auch zwischen altem und neuem Testament geändert haben. Wir Menschen können gar nicht anders, als uns Gott im Rahmen unserer Konstrukte vorzustellen. Ändert sich der Mensch, die Kultur, die Gesellschaft, so verändern sich damit logischerweise die Gottesvorstellungen.
Wichtig ist es, nach der Aussagerichtung/Intension der Texte zu fragen und nicht am Buchstaben zu kleben.
Für eine wortwörtliche Auslegung der Bibel bleibt somit nur noch ein eingeschränkter Spielraum. Die gesellschaftlichen und persönlichen Umstände – die Konstrukte – haben die grundsätzliche Intention von Liebe und Barmherzigkeit oft genug verdunkelt. Wichtig ist es deshalb, jeweils nach der Aussagerichtung der Texte zu fragen und nicht am Buchstaben zu kleben.
Konstruktivismus und die rechte Lehre
Ein vorherrschendes Konstrukt in den ersten Jahrhunderten nach Christus war die Logik und Systematik im Nachgang zur damals vorherrschenden Philosophie im Römischen Reich. Auch die christliche Lehre wurde in ein logisches System gezwängt. Prinzipiell spricht ja nichts gegen die Logik und deren Anwendung. Wenn es jedoch um die Beschreibung des Göttlichen geht, dann versagt die menschliche Logik. Beim Göttlichen gilt eine andere Weisheit und die Weisheit der Welt kann diese nicht erreichen oder beschreiben. Paulus spricht in diesem Zusammenhang von der Weisheit dieser Welt, die Torheit bei Gott ist.
Weil zeitbedingte Konstrukte sich im Laufe der Zeit verändern, dürfen wir daraus keine Lehraussagen machen. Genau das tat Augustinus mit der Erbsünde und viele Theologen vor und nach ihm.
Noch kritischer wird es, wenn es u. a. über Glaubensfragen zu einer Kirchenspaltung kommt. Anstatt die jeweils andere Meinung zu tolerieren und diese möglicherweise als Bereicherung zur eigenen Sichtweise anzuerkennen, kam es darüber zu Kirchenspaltungen. Und es gab zahlreiche Spaltungen, bei denen es um die „richtige“ Wahrheit ging. Und alle hatten zumindest ein Körnchen Wahrheit in ihrer Lehre. Im Urchristentum herrschte eine andere Haltung vor. Hier ging es darum, Gott überall dort zu erkennen, wo er schon am Werk war. Petrus wurde aufgefordert, das Unreine und Unheilige zu schlachten und zu essen. Gott hatte es für rein erklärt und damit ein vorherrschendes Konstrukt im jüdischen Denken aufgebrochen: Kein Kontakt mit Nicht-Juden! Entscheidend war, dass der Hauptmann Kornelius gottesfürchtig war, der die Armen unterstützte. Petrus erzählt ihm und seinem Haus von Jesus und seiner Auferstehung und alle werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Petrus zieht die Schlussfolgerung: „Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist.“
Wie universell und wie einfach! Was haben wir hingegen für eine Kasuistik und Lehre aufgebaut. Und wer nicht genau unserer Meinung ist, wird ausgeschlossen. Aber geht es nicht auch anders? Ja, Papst Franziskus verkündet diesen Weg der Barmherzigkeit. Das ist es, was dieser Welt und den Menschen gut tut. Barmherzigkeit überwindet Grenzen und Konstrukte, die uns voneinander trennen.
[1] Schmitt et al. [2] Simon (2015), 10f [3] Ex 20,4 [4] Gal 2,28
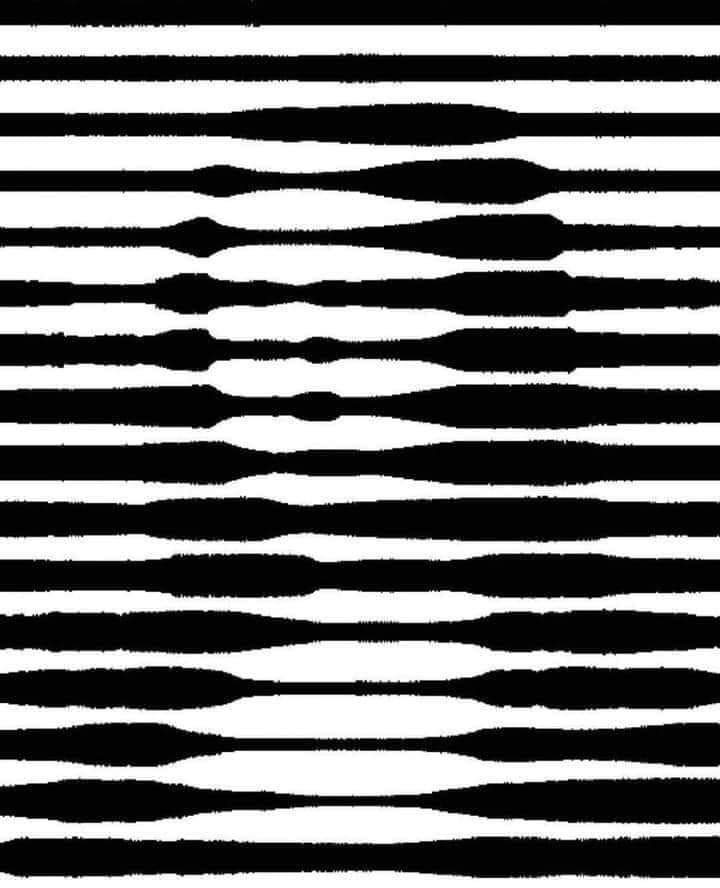
Schreibe einen Kommentar